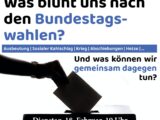Bericht zur Kundgebung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus
02/02/2025„Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau“
Paul Celan, Todesfuge
Über 250 Leute kamen am Sonntag, dem 02. Februar, zur Kundgebung an der Gedenkstätte „Zeichen der Erinnerung“ am Nordbahnhof in Stuttgart. Von diesem Ort aus wurden ab 1941 über 5000 Menschen zu ihrer Ermordung deportiert. Anlass der Kundgebung war der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, der 27. Januar, der den Jahrestag der Befreiung des wohl bekanntesten Vernichtungs- und Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau und Monowitz markiert.
Die Todesfuge von Paul Celan bildete den Rahmen der Kundgebung und klang immer wieder an. Das Gedicht warf uns mitten in die Auseinandersetzung mit Nazideutschland, unserer Vergangenheit und unserer Verantwortung heute. Gerade heute, in einer Zeit, in der Muster der Entmenschlichung, der Verfolgung Andersdenkender, der Ignoranz gegenüber Marginalisierten sowie Muster menschenverachtender Politik in Deutschland (und weltweit) immer offensichtlicher werden und zunehmend die Zustimmung breiterer Teile der Bevölkerung erfahren, ist es wichtiger denn je, nicht nur zu erinnern und zu gedenken, sondern auch zu kämpfen – damit das „Nie Wieder“ Realität wird.
In der Moderation und den Redebeiträgen wurden die historischen Ereignisse thematisiert und Bezüge zur heutigen Situation hergestellt. In der Rede der Organisierten Autonomie stand vor allem die Frage im Mittelpunkt, welche Mechanismen den Nationalsozialismus und letztlich das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte ermöglichten. Zudem rückte die Auseinandersetzung mit uns selbst sowie die Frage in den Fokus, wie gegen Verhältnisse vorgegangen werden kann, die solche Gräuel erneut ermöglichen könnten. Der Redebeitrag des Antifaschistischen Aktionsbündnis Stuttgart & Region (AABS) schlug eine Brücke zur Gegenwart und betonte anhand der aktuellen Situation die Notwendigkeit, auch heute organisiert gegen Faschismus aktiv zu werden (die Redebeiträge findet ihr unten). Musikalisch wurde die Kundgebung durch Luna am Cello begleitet.
Lasst uns daran anknüpfen und auch in Zukunft den 27. Januar gemeinsam zu einem Tag des Erinnerns, Gedenkens und Kampfes machen – aber auch zu einem Tag der Auseinandersetzung mit uns selbst, der Gesellschaft und den Verhältnissen, in denen wir leben. Nutzen wir diesen Tag, um die Frage aufzuwerfen, in welchen Verhältnissen wir gemeinsam leben wollen, und lasst uns diesen Tag dafür nutzen, von dem das klare Signal ausgeht: Nie wieder!






Reden
- Rede der Organisierten Autonomie Stuttgart
- Rede des Antifaschistischen Aktionsbündnis Stuttgart & Region
Rede der Organisierten Autonomie Stuttgart
„Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau“
So einige Zeilen aus dem wohl bekanntesten Gedicht über Auschwitz. Geschrieben von Paul Celan – einem deutschsprachigen Juden aus Bukowina und Überlebender der Shoa – erstmals veröffentlicht 1948. Von Schulbüchern bis in Liedtexte von Punkbands schafften es Versatzstücke dieses Gedichts und verlor dabei aber auch seine spezielle Wirkung, die sich erst bei genauem Hinhören und Lesen eröffnet. Es ist vielleicht damit auch ein Zeugnis darüber, wie wir heute mit dem wohl größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte umgehen.
Was hat denn die dritte oder vierte Nachkriegsgeneration mit den Verbrechen der nationalsozialistischen Mehrheitsgesellschaft zu tun? Woher kennen wir denn den Holocaust, die Shoa, die Euthanasiemorde, die größte verbrecherische materielle Landnahme, die wir kennen – Ja woher kennen wir heute die Verbrechen der Nazis?
Zumeist aus dem Unterricht, einem Museumsbesuch oder dem erzwungenen schulischen Besuch einer Gedenkstätte, vielleicht aber auch aus dem ein oder anderen Fachbuch und Fernsehdokumentation.
Wenn wir uns allerdings ehrlich machen, erfolgt die heutige Vermittlung der Geschehnisse zwischen 1933 und 1945 hauptsächlich über Hollywoodfilme, fiktionalen Romane oder fragwürdigen Dokumentarfilme à la Hitlers Helfer. Alle haben eines gemeinsam – sie müssen sich refinanzieren und den Autor*innen auch noch den Broterwerb garantieren. Allzu oft bedienen sie sich deshalb dem üblichen Gut-Böse Schemata oder spielen mit dem anscheinenden faszinierenden Grusel des Massenmordes.
Eine rationale oder gar wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen findet nicht statt, das beweisen Filme wie „Inglorious Basterds“, „Das Leben ist schön“, „Schindlers Liste“ oder ähnliche Machwerke. Sie sind es aber, die unsere Vorstellungen über den Holocaust zu großen Teilen prägen. So verwundert es auch nicht, dass aktuelle Untersuchungen unter Jugendlichen zeigen, dass das Wissen über die Zeit des Nationalsozialismus deutlich zurückgeht.
Eines aber wird bei genauerer Beschäftigung mit den Verhältnissen im Nationalsozialismus deutlich: Für diejenigen, denen wir heute Gedenken, gab es weder ein Happy End noch war ihr Leben durch besonders heroische Heldengeschichten geprägt.
Bei den meisten ging es einfach um das nackte Überleben und darum ihrer Ermordung zu entgehen, welche zumindest in den allermeisten Fällen nur aus einem einzigen Grund erfolgen sollte – weil sie Jüd*innen, Sinti*zze, Rom*nja waren, weil sie krank, körperlich oder geistig beeinträchtigt waren, aus der Sowjetunion oder Osteuropa stammten oder homosexuell waren.
Und so ist Celans Gedicht auch keine leichtfüßige Lyrik, die so einfach rezitiert werden kann, sondern eine Form der Auseinandersetzung eines Überlebenden mit dem Erlebten. Das Gedicht katapultiert uns mitten in unsere Auseinandersetzung mit Nazideutschland, unserer Vergangenheit und unserer Verantwortung heute.
„Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland“
Kein anderer Ort steht so symbolisch für dieses Meisterstück wie das Vernichtungslager Auschwitz.
Am 27. Januar 1945 gegen 15:00 Uhr erreichten zwei vermummte sowjetische Rotarmisten mit ihrem auf einen Schlitten montiertem Maschinengewehr das schneebedeckte Tor von Auschwitz-Birkenau. Ein Freudenschrei erhob sich unter den noch ca. 7000 verbliebenen Gefangenen.
Ja, der 27. Januar war auch ein Tag der Freude, ein Tag der Befreiung.
Für über 1,3 Millionen Menschen, die meisten davon Juden und Jüdinnen kam die Befreiung allerdings zu spät. Sie wurden in der industriellen Mordmaschinerie der Nazis erst entrechtet, verfolgt, deportiert und schlussendlich in Auschwitz ermordet.
In der Zeit von 1933 bis 1945 wurden über 6 Millionen Jüdinnen, 7 Millionen sowjetische Zivilisten, 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene, knapp 2 Millionen polnische Zivilisten, 300.000 serbische Zivilisten, 250.000 Sinti*zze und Rom*nja, 250.000 kranke und körperlich oder geistig beeinträchtigte Menschen, 70.000 sogenannte Asoziale und Wiederholungsstraftäter und tausende andere Menschen, die nicht in das Weltbild der Nationalsozialisten passten erschossen, vergast oder durch Verhungern-lassen ermordet.
Das ist das Meisterstück, das Celan in seiner Lyrik hervorholt – den industriell organisierten Massenmord einer ganzen deutschen Generation. Denn eines ist doch ziemlich deutlich – ohne die Zustimmung der damaligen deutschen Mehrheitsgesellschaft wäre ein solches Verbrechen sicherlich nicht möglich gewesen.
Und darin liegt auch die Singularität des Verbrechens. Dabei geht es nicht darum zu postulieren, alle Deutschen haben aktiv gemordet oder nach Blut gelechzt. Allerdings muss man konstatieren, dass hunderttausende Deutsche aus allen sozialen Schichten, mit völlig verschiedenen Bildungshintergründen, mit ganz unterschiedlichen sozialen Hintergründen direkt in nationalsozialistischen Verbrechen beteiligt waren.
Hätte man dieselben juristischen Maßstäbe 1950 – 1970 angelegt, die heute zur Verurteilung von 95-jährigen Greisen wegen Beihilfe zum Mord führen – es hätte über 300.000 lebenslängliche Urteile an deutschen Männern und Frauen gesprochen werden müssen. Das zur gesellschaftlichen Involviertheit
Aber uns geht es heute nicht um diesen Umstand! Uns geht es heute schlicht darum, genau hinzusehen und zu verstehen, wie dieser breite gesellschaftliche Konsens zum Verbrechen hergestellt werden konnte und welche Wirkmechanismen dahinterliegen. Wie konnte der Tod ein Meister aus Deutschland werden und was hält uns davon ab, dass er es wieder wird?
Sicherlich wäre es vermessen, eine allumfassende Erklärung zu versuchen und sicherlich erst recht im Rahmen eines Gedenkens. Dennoch wollen wir heute einen Aspekt einer Erklärung skizzieren, der uns nur allzu nah ist, menschlich nicht fremd und der uns immer wieder in ganz anderer Form begegnet – der Aspekt der sozialen Bestechung!
Denn die nationalsozialistische Volksgemeinschaft sollte ja eines schaffen – den vermeintlichen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit in ihr aufzulösen. Und das tat sie auch zum Teil, in dem Sie Wohltaten an die Arbeiterschaft verteilte: Erhöhung der Renten im zweistelligen Bereich, Beitritt der Rentner in die Krankenkassen, Steuerfreiheit auf Schichtzuschläge, Lohnfortzahlung für den Ersten Mai, Ehegattensplitting, Familienlastenausgleich, Aussetzung von Zwangsvollstreckungen und so weiter. Finanziert wurden diese staatlichen Wohltaten größtenteils durch Zwangsarbeit, Enteignung von deportierten und ermordeten Jüd*innen, der Ausplünderung der besetzten Gebiete und dem Verhungern-lassen von Millionen von Menschen in Osteuropa und der Sowjetunion. Nutznießer waren alle im Reich. Während die einen Profite durch die Kriegswirtschaft erhielten, bekamen die anderen soziale Errungenschaften und mehr Geld und Konsumgüter in die eigene Tasche. Ein System, das aber ohne den Massenmord und den Krieg nicht möglich war und wäre.
Gerade der Krieg und seine Gräueltaten machten die Vorstellung eines Ausgleichs zwischen Kapital und Arbeit ohne eigenen Wohlstandsverlust noch reizvoller. Dies ließ das Hinterfragen, genaue Hinsehen und die Beschäftigung mit den Fakten in den Hintergrund treten, ebenso wie die Entwicklung einer widersprüchlichen Position. Ein Mechanismus, der so normal und menschlich ist, sodass jeder und jede von uns diesen kennt.
Es gehört aber auch dazu, dass es ein Mechanismus ist – und hier sei ausdrücklich betont, nur ein Mechanismus von Vielen – der dieses System und damit auch letzten Endes den Massenmord ermöglichte. Damit darf in keiner Weise die Verantwortung derjenigen negiert oder kleingeredet werden, die diesen Konsens organisiert haben. Die treuen NSDAP-Politiker, die Wehrmachtsgeneräle, der deutsche Schwertadel, die Bürokraten und Technokraten, die Eliten der Vernichtung, die SS und SA Schwadronen und viele viele mehr.
Heute jedoch möchten wir bewusst den Fokus auf die soziale Bestechung legen – jenen Mechanismus, der die stille Zustimmung der Bevölkerung organisiert und ohne den das größte Menschheitsverbrechen nicht möglich gewesen wäre. Denn dieser Mechanismus berührt uns als Linke, als Antifaschist*innen, als Menschen und rückt unsere alltäglichen Handlungen in den Mittelpunkt und bleibt nicht bloß eine abstrakte Anklage gegen andere. Und deshalb ist es notwendig, auch darüber zu sprechen.
Heute, 80 Jahre nach der Befreiung des größten Vernichtungslagers, wollen wir den Opfern dieses mörderischen gesellschaftlichen Konsenses gedenken. Dabei ringen wir um Fassung, ob der Taten der nationalsozialistischen Gesellschaft.
Doch was ist morgen? Was ist übermorgen? Der Kampf gegen Faschismus und Barbarei beginnt nicht mit der Erinnerung oder dem Gedenken, sondern mit Reflexion dessen, was war, und der Analyse, wie es dazu kommen konnte – um das zu bekämpfen, was den Nationalsozialismus möglich machte. Nicht durch Phrasen, nicht durch blinden Aktionismus, nicht mit verkürzten Analysen oder politischen Ränkespielen.
‚Nie wieder‘ ernst zu nehmen bedeutet, jeden gesellschaftlichen Konsens zu verhindern, der das eigene Leben auf der Ausmerzung anderer aufbaut. „Nie wieder“ ernst zu nehmen bedeutet, gegen eine Gesellschaft zu sein, die auf Konkurrenz, Ausbeutung und Unterdrückung basiert. Es muss darum gehen, die Grundlagen dieser Konkurrenz, des Kampfes des Menschen gegen den Menschen, zu beseitigen. Es muss darum gehen, Verhältnisse zu schaffen, in der der Mensch der Entfremdung von sich selbst entsagen kann.
Dies auf kollektiver Ebene zu tun und gemeinsam nicht nur in Betroffenheit zu verharren, sondern aktiv für mehr als ein bloßes Dagegen einzutreten, muss unser Ziel und unsere Aufgabe sein. ‚Nie wieder‘ bedeutet für uns, gegen die herrschenden Verhältnisse zu kämpfen, die solche Gräuel immer wieder ermöglichen.
So heißt es für uns: Nie wieder Faschismus – Nie wieder Krieg – Nie wieder Auschwitz
– Für ein ganz Anderes – Für eine solidarische Gesellschaft!
Rede des Antifaschistischen Aktionsbündnis Stuttgart & Region (AABS)
„Es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen“
Primo Levi – Auschwitz-Überlebender
Für uns als Antifaschistinnen und Antifaschisten ist Gedenken ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit. „Erinnern ist arbeiten an der Zukunft“- und in diesen Zeiten umso notwendiger.
Zeigen wir der AfD und allen anderen Menschenfeinden, dass wir da sind und „Nie wieder Faschismus“ keine Floskel ist, sondern ein Versprechen, dass wir mit Inhalt und Leben füllen.
Wir kämpfen dafür, dass Gedenken und Erinnern nicht nur in Museen und angestaubten Ecken unserer Gesellschaft stattfindet, sondern aktiver Teil unseres Lebens ist und sichtbar wird auf den Straßen und in unseren Kämpfen/unserer Politik.
Eine aktive Erinnerungskultur ist wichtig. Den Anfängen zu wehren und dem Faschismus Einhalt zu gebieten – das Schaffen keine ritualisierten Gedenkveranstaltung, sondern Aufklärung über die Geschichte und politische Einordnung, um letztlich aktiv einschreiten zu können, wenn rechte Narrative/ Hetze wieder um sich greifen, wie es aktuell verstärkt passiert.
Heute sind wir hier am Stuttgarter Nordbahnhof zusammen gekommen, um an die Opfer des Holocaust zu gedenken, die auch von hier in den Tod geschickt wurden. Wir erinnern an die mutigen Menschen, die sich dem Faschismus widersetzt haben und das meist mit dem Leben bezahlten.
Auch aus Stuttgart gab es Deportationen; ab 1941 wurden Jüdinnen, Juden und Sinti und Roma, politisch Verfolgte, und andere Verfolgte im Durchgangslager auf dem Killesberg zusammengetrieben. Und dann hier, wo wir grade gemeinsam stehen, wurden Menschen, die aus Stuttgart und Umgebung stammten, in Züge verladen die dann unter anderem nach Riga, später nach Theresienstadt und Auschwitz deportiert. Nur wenige überlebten, die Liste der Stuttgarter:innen, die in Auschwitz oder anderen Lagern starben, ist lang.
Die Folter, Menschenversuche und massenhafte Ermordung durch Erschießungen und Vergasung wie im KZ Auschwitz zeigt die bis ins Letzte geplante faschistische Vernichtungsmaschinerie – die mit nichts in der Geschichte zu vergleichen ist.
Wir halten die Erinnerung wach und ziehen Lehren aus unserer Geschichte. Dafür steht für uns der 27. Januar. Doch das reicht nicht: Wir müssen aktiv werden!
Während wir heute an die Opfer des Holocaust gedenken, sind Rassismus und faschistische Ideologien wieder salonfähig geworden. Und auch gerade während des Wahlkampfs nutzen die vermeintlich „linken“ Parteien SPD und Grüne Gedenktage wie den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, um sich zu profilieren.
Auf großen Demonstrationen, wie es sie gerade in vielen deutschen Städten gibt, rufen sie zum gemeinsamen antifaschistischen Kampf gegen CDU/AfD auf, treiben aber gleichzeitig die Rechtsentwicklung mit ihrer Regierungspolitik massiv voran.
Sie reagiert mit Abschiebungen, Sozialabbau und Aufrüstung im Inneren und Äußeren auf die aktuellen Krisen.
Hier geht es nicht um ehrlichen Antifaschismus, sondern um den Machtkampf zwischen verschiedenen Blöcken der Herrschenden. Damit soll nicht gesagt sein, dass es an der Basis dieser Partei nicht viele ehrliche Antifaschist:innen gibt. Auf diese Basis müssen wir zugehen und alle denen, die es ernst meinen, ein Angebot im gemeinsamen Kampf gegen die Rechtsentwicklung machen.
Rechtsentwicklung ist dabei mehr als das Erstarken der AfD und eine Merz-CDU – sie ist in verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft klar zu erkennen: wie die
- Hetze gegen Geflüchtete
- massive Aufrüstung
- Ausbau des Sicherheitsapparats und Gesetzesverschärfungen
- die Abwälzung der kapitalistischen Krise auf uns alle und damit verbunden sozial Abbau
- Sexismus und Queerfeindlichkeit nehmen zu und entladen sich gewalttätiger,
Das konnten wir im letzten Jahr auf CSDs deutlich sehen, unter anderem wie sich Nazis wieder vermehrt die Straße nehmen und sich damit sehr wohlfühlen.
Wollen wir diese Entwicklung nach rechts wirklich stoppen, müssen wir untereinander – nach innen – Gemeinsamkeiten und Bezüge herausstellen. Die Ursachen klar benennen und uns mit jenen solidarisieren, die schon jetzt und der Krise oder der aktuellen Politik leiden.
Wir müssen uns organisieren. In Asylrechts-Orgas, in Antifa-Gruppen, migrantischen Organisationen oder feministische Initiativen. Und das heißt auch über die jeweiligen Organisationen hinweg solidarisch an der Seite anderer zu stehen, wenn der Staat versucht, konsequenten Antifaschismus zu kriminalisieren und mit Repression zu überziehen.
Auch im aktuellen Wahlkampf wird einmal mehr deutlich, dass die rechte Entwicklung in Deutschland nicht nur von der AfD vorangetrieben wird und dass das gesellschaftliche Problem viel tiefer liegt:
In den antisemitischen Kontinuitäten in diesem Land, die mit 1945 nicht gebrochen wurden, mit rechtsterroristischen Verstrickungen in Behörden, Polizei und Bundeswehr, mit einem strukturellen und alltäglichen Rassismus, der auch 2025 Menschenleben kostet, in der Spaltung der Gesellschaft, im Aushöhlen von Sozialstaat und Menschenrechte der herrschenden Klasse und ihrer Sicherheit
die Liste ist lang und sollte klarmachen: Wir müssen selbst Verantwortung übernehmen –
lasst uns gemeinsam gegen Rechts kämpfen, für ein solidarisches Miteinander eintreten und für eine bessere Gesellschaft streiten!
„Ihr seid nicht schuldig für das, was damals geschehen ist,“ sage ich, „aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts von dieser Geschichte wissen wollt.“
Esther Bejarano
Der Kampf gegen die Rechtsentwicklung, gegen Rechte aller Art. muss konsequent geführt werden – 365 Tage im Jahr!
Denn wir dürfen Rechten weder den Diskurs noch die Straße überlassen – weder in Stuttgart noch sonst irgendwo. Unsere Wahl – Konsequent gegen Rechts – Kampf dem Faschismus